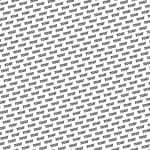Spaß am eigenen Hobby ist etwas, was man gerne mit seinen Kindern teilt. Radfahren sollten Kinder sowieso lernen, was liegt also näher, als ihnen Radsport schmackhaft zu machen? Das kann funktionieren, aber erzwingen lässt es sich nicht. Und vor allem muss man die eigenen Ambitionen stark zurückschrauben und ziemlich viel Geduld und Augenmaß walten lassen. Ich habe drei Söhne. Zwei konnte ich für Radsport begeistern, zumindest phasenweise, einer fand wenig Gefallen daran. Wie die Dinge ins Rollen kamen, lesen Sie im Folgenden.
Kinder und Radsport in fünf Phasen
- Phase 1 (0,5 bis 3 Jahre): Sitzen die Kinder im Anhänger, ist die relative Freiheit der Eltern am größten.
- Phase 2 (3 bis 6 Jahre): Kinder lernen selbst fahren – spielerisch mit Abschleppen oder Nachläufern. Eltern müssen sich stark zurücknehmen.
- Phase 3 (7 bis 10 Jahre): Der Aktionsradius wird größer. Kinder erlernen technische Skills. Erste Wettkämpfe finden statt. Kleine Touren mit Kindern sind möglich.
- Phase 4 (11 bis 13 Jahre): Kinder werden ausdauernder, gemeinsamer Sport ist möglich, Wettbewerbe werden härter.
- Phase 5 (14 Jahre und älter): Abnabelung. Bleiben die Jugendlichen bei der Stange, können sie ab 15 Jahren stärker werden als die Eltern.
Phase 1: Abschleppen
Es gibt Kinder, die es lieben, im Anhänger gezogen zu werden. Nicht stundenlang, aber immerhin lange genug, damit die gemeinsame Ausfahrt auch sportlichen Charakter hat. Ich hatte Glück. Meine Kinder hatten alle nichts gegen Anhängerfahrten in der richtigen Dosis einzuwenden, was, wie ich von Freunden weiß, nicht immer der Fall ist. Ich investierte sofort nach der Geburt des Ältesten in einen gebrauchten Singletrailer. Das ist der einzig ernstzunehmende Anhänger in einem Meer mediokrer Konstruktionen. Teuer, aber jeden Cent wert. Damit wandelte ich auf Florian Wiesmanns Spuren. Denn der Rahmenbauer in der Schweiz entwickelte dieses fantastische Gefährt, um seinen Nachwuchs mit auf den Trail zu nehmen. Genau das tat ich auch. Ich mied Straßen und fuhr mit meinem Sohn Ben meist durch Forst und Tann, bergauf und bergab. Als Zugmaschine wählte ich das Mountainbike.

Bergauf war das fordernd, bergab ein großer Spaß. Passte mein Lenker zwischen den Bäumen durch, war ich sicher, dass der viel schmalere Anhänger folgen konnte. Mit weich eingestelltem Downhill-Fahrwerk und 200 Millimetern Federweg ist der Singletrailer eine Sänfte. Selbst eine Treppe nimmt das Gespann weicher als ein Standardanhänger eine schlechte Straße. Mitunter jauchzte Ben hinten vor Freude, wenn wir es bergab laufen ließen. Die erste Lektion, die ich ihm nahebrachte: Wenn es rauscht und die Baumwipfel über seinem offenen Verdeck vorbeifliegen, ist es gut. Zwischenstopps an Waldspielstellen stellten sicher, dass es nicht zu langweilig für ihn wurde. Als mein zweiter Sohn Leo auf die Welt kam, erweiterten wir den Fuhrpark um ein zweites Gespann, und meine Frau Andrea zog fortan auch einen Singletrailer.
Dies bescherte uns ein oder zwei Jahre, in denen wir auch als Familie gemeinsam ziehend die Natur durchpflügten. Die sportliche Einschränkung war subjektiv gering und wir konnten gemeinsam unserem Hobby nachgehen. Im Urlaub machten wir mit den Hängern Halbtagestouren mit Abenteuercharakter. Selbst knackige Trails, zum Beispiel in Finale Ligure, waren mit diesen Hängern machbar. Rückblickend eine gute Zeit, die uns sportlich forderte, aber auch das Familienteam formte. Die Hänger ohne E-Unterstützung bergauf zu treten, erforderte reichlich Muskelschmalz und hielt uns fit. Ein letztes Aufbäumen vor Phase zwei, die einen völlig anderen Charakter bekommen sollte.

Wir sprengten das System mit der Geburt unseres dritten Sohnes. Ein Versuch, zwei Kinder in einem üblichen Doppelsitzer und eines im Singletrailer zu ziehen, scheiterte an meiner endlichen Beinpower und am Wesen des Doppelsitzers. Das Ding erwies sich in vielerlei Hinsicht als Fehlkonstruktion und senkte den Fahrspaß so weit, dass klar wurde: Phase 1 war an ihr natürliches Ende gekommen. Fünf waren einer zu viel.
Phase 2: Selbst fahren
Mit dreieinhalb Jahren lernte Ben selbst zu fahren. Eigenes Treten und letzte Anhängerfahrten überschnitten sich kurz, dann war klar, er würde fortan nur noch selbst treten wollen. Mit den winzigen 16-Zoll-Rädern gab es im Wald einiges zu tun. Aber Kania sei Dank, fanden schon diese ersten Ausflüge aus eigener Kraft mit durchdachtem und gutem Material statt. Kleine, auf Kinderräder spezialisierte Anbieter, hatten und haben die besseren Angebote als die großen Bike-Firmen, die das Thema Kinderrad nicht richtig ernst nehmen. Leo lernte vor seinem dritten Geburtstag Rad fahren und schloss sich alsbald der Tretfraktion an, sodass wir nun als Mixed-Team unterwegs waren. Ein Sohn im Hänger, zwei eigenständig fahrend.

Im Unterschied zu Phase 1 wurden die Strecken viel kürzer, da die Kinder selbst treten mussten. Sport war es für uns Erwachsene zwar nicht mehr, aber Spaß mit der Familie auf Rädern hatten wir auch so. Das Erlernen der Fahrtechnik stand im Vordergrund. Wir fuhren kleine Runden im Stadtwald und genossen in den Ferien das familienfreundliche Revier in Punta Ala in der Toskana, das Trail-Vergnügen und Spaß am Meer so effektiv verbindet wie kein anderes. Wir hielten an natürlichen Hindernissen, übten die Linienwahl und die Fahrtechnik. Die Räder wuchsen flott mit. 20-Zoll-Räder gingen schon etwas geschmeidiger über die Wurzeln.
Versuche, an den Singletrail-Anhänger noch ein Kind per Expander zum Ziehen anzuhängen, waren nicht nur positiv – das Gespann wurde dadurch zu lang und zu unübersichtlich. Versehentlich zog ich auch mal ein gestürztes Kind weiter über den Schotter, ohne dass sich der gefühlte Fahrwiderstand groß änderte. Das Tempo war sehr niedrig in dieser Phase. Es war Geduld gefragt und die Erwachsenen mussten sich solo austoben, wenn sich dafür ein Zeitfenster anbot. Die persönliche Fitness ging in dieser Phase logischerweise zurück. Wenig und langsam fahren ist kein Rezept für Bestform.
Phase 3: Durchbruch mit 26 Zoll
Den Durchbruch im Selbstfahren ermöglichten die ersten 26-Zoll-Räder, die mit sechs Jahren fahrbar wurden. Das Konzept ähnelte dem der 29-Zoll-Räder für Erwachsene: zwischen den Rädern sitzen statt darüber. Damit machten die Kinder schnell riesige Sprünge in der Fahrtechnik und konnten Spaß-Trails flüssig fahren; durchaus so, dass ich mich nicht zu Tode langweilte, wenn ich ihnen folgte. Mit diesen Rädern wurde der Unterschied zu gewöhnlichen Kinderrädern – schwer, kleine Laufräder, miese Geometrien – mehr als offensichtlich. Die Erkenntnis daraus: Wer sich und seinen Kindern etwas Gutes tun will, sollte nicht beim Material sparen. Zwar ist die Nutzungsdauer begrenzt, weil Kinder schnell wachsen, aber der Wiederverkaufswert von guten Kinderrädern ist hoch. Die tatsächlichen Nutzungskosten sind daher gar nicht so dramatisch.
Die größeren Laufräder ebneten auch den Einstieg in den Rennsport für die Kinder. Ab der U7 begannen die beiden älteren Söhne, Mountainbike-Rennen zu fahren. Warum MTB? Weil Straßenrennsport in diesem Alter schlicht nicht sinnvoll ist. Die eigenen Kids zu Rennen zu begleiten, schuf eine neue Perspektive: nämlich sie beim Wettstreit mit anderen zu unterstützen. Es gab sehr viel zu lernen: Krafteinteilung, Positionierung, Fahrtechnik, Fair Play und den Umgang mit den Höhen und Tiefen des Wettkampfsports. Kinder sind in diesem Alter spielerischen Dingen gegenüber aufgeschlossen. Sie haben einen natürlichen Bewegungsdrang, aber nicht die Art von Zähigkeit, die Ausdauersport erfordert. Sie sind mehr Seriensprinter als Dauerstrampler.

Den Kindern beim Rennfahren zuzuschauen, war daher von Beginn an ambivalent. Nicht wenige übernehmen sich anfangs, was zu hässlichen Szenen führt. Schreiende Eltern, weinende Kinder. Nichts, was Spaß macht. Gut waren Rennen, welche die Kinder technisch forderten. Manchmal waren auch Qualifyings vorgeschaltet, bei denen es nur um Geschicklichkeit und nicht um Ausdauer ging. Das zeigte in die richtige Richtung. Für stumpfsinniges Ausdauertraining bleibt später schließlich noch reichlich Zeit.
Phase 4: Gemeinsames Training und Rennen
Ab elf Jahren sind talentierte Jungsportler in der Entwicklung so weit, dass sie größere Runden drehen können. Gemeinsamer Sport wird möglich. Meine Kinder waren nie Fans tagesfüllender Kurbelei, aber in Trainingscamps wurden in der Gruppe auch schon mal 100 Kilometer am Stück abgespult. Auf dem MTB keine Kleinigkeit.
Ich musste einsehen, dass Radfahren eine Randsportart ist, und eine förderliche Gruppendynamik auch Glückssache. Wir fuhren noch zu einigen Wettkämpfen, darunter auch Bergzeitfahren, bei denen wir als Familienteam an den Start gingen. Das brachte gemeinsame Erfolge, aber es war früh zu spüren, dass die Rennkarriere der Kinder nicht geradlinig weiterführen würde.

Phase 5: Abnabelung und eigene Wege
In der U17 fuhr mein ältester Sohn noch ein Rennen, dann wechselte er zum Fußball. Das ist der Sport, den alle seine Freunde betreiben. An einem gewöhnlichen Trainingstag ist beim Fußball in der Kleinstadt mehr los als bei einem Radrennen mit 100 Kilometern Einzugsradius. Er hat daher mein volles Verständnis für den Wechsel der Sportart. Sein Abschied vom Rennsport ist keine Ausnahme. Die Teilnehmerzahlen sind ab der U15 rückläufig und brechen in der U17 völlig ein. Sein Bruder Leo zeigte sich solidarisch und stellte die Rennkarriere in der U15 ebenfalls ein. Wir fahren weiter ab und zu zusammen Rad. Manchmal sogar Rennrad.
Ich fahre nun wieder mehr mit meinen Freunden. Mein Fitness-Abstand zu den Kindern legt damit trotz meines fortgeschrittenen Alters wieder zu. Eine Zeit lang sah es so aus, als ob meine Kinder konditionell aufschließen könnten. Denn das wäre normal: Ab 15 Jahren können junge Radfahrer ähnlich leistungsfähig sein wie erwachsene Radsportler. Aber nur, wenn sie trainieren. Die Kraft und Furchtlosigkeit der Jugend zeigt sich anderswo: Im Bikepark habe ich jetzt endgültig das Nachsehen. Die Jungs fahren mir in den technischen Sektionen davon. Ich finde das gut. Denn das war der Plan.
Im Prinzip lasse ich mich zwar nicht gerne abhängen. Von niemandem. Aber bei meinen Kindern überwiegt dann doch der Vaterstolz. Und dass sie mir davoneilen, zeigt ja, dass dieser Teil der Ausbildung auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Ich bilde mir ein, eine direkte Linie zwischen ersten Gespannfahrten und der Downhill-Action von heute zu sehen. Vielleicht finden sie später Gefallen am Rennradfahren und gewähren mir die Gunst ihres Windschattens.