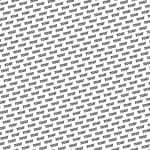Mit dem Rennrad durch den Westen der Ukraine - ein Bericht von TOUR-Leser Arnold Zimprich:
Mit kleinen Pfützen übersät, schlängelt sich der sandige Feldweg den Waldrand entlang. Es hat geregnet, Pfützenslalom ist angesagt. Ich ertappe einen Hasen beim Morgenputz. Was idyllisch klingt, ist mit dem Rennrad eine Herausforderung. Längst schon wollte ich 200 Kilometer und mehr pro Tag machen. Doch so läuft das nicht… Rennradfahren in der Ukraine will gut vorbereitet sein. Das dachte ich mir auch - und plante meine Route minutiös per Komoot. Nach einem Hilfseinsatz in der Westukraine will ich mit dem Renner zurück nach Deutschland. Über 1200 Kilometer, sechs Tage habe ich Zeit. Doch schon am ersten Tag, an dem ich in Brody, einer Kleinstadt 100 Kilometer nordöstlich von Lviv starte, zeigen mir die ukrainischen Straßen die Zähne und Komoot, dass es zur Navigation in der Ukraine zwar nicht gänzlich ungeeignet, aber mit großer Vorsicht zu genießen ist.
Kopfsteinpflaster in der Ukraine
Zwar habe ich bei der Routenerstellung selbstverständlich “Rennrad” als Sportart angegeben, die App leitet mich jedoch über zum Teil heftige Schotter- und Kopftsteinpflasterpisten. Könnte man letzteres noch als Paris-Roubaix-Reminiszenz verbuchen, stellen die Schotterpisten einen Parforceritt dar, wie ich ihn nicht geplant habe. Zu meinem großen Glück habe ich nagelneue Reifen draufgezogen. Mit diesen Endurance-Langstreckenreifen erleide ich - ich kann es immer noch nicht fassen - keinen einzigen Platten. Allein das Vorwärtskommen in der Ukraine funktioniert nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich beende den ersten Tag nach knapp 180 statt nach 200 oder mehr Kilometern.
Ohne Radhose über Schotterpisten der Ukraine
Ich hätte es eigentlich besser wissen müssen. Im August 2024 war ich mit dem Gravelbike in der Ukraine unterwegs, schon damals zwangen mich die ukrainischen Nebenstraßen fast in die Knie. Doch der Wunsch, zumindest in der Theorie schnell vom Fleck zu kommen, siegte über die Vernunft. Dabei fiel mir schon im vergangenen Jahr auf, dass die am besten geteerten Straßen von Lviv nach Westen aus Kriegsgründen noch stärker befahren sind als zu Friedenszeiten. Sie sind die Pulsadern des Landes. Als ich das letzte Jahr rund 30 Kilometer zwischen Iwano-Frankowe und Jaworiw auf der E40 zubrachte, reichte es mir bald mit den “Nahtoderfahrungen”. Warum, in aller Welt, sollten LKW-Fahrer mit kriegswichtigen Gütern auch auf durchgeknallte Radler achten? In Jaworiw legte ich mich damals erstmal eisschleckend in den Schatten. Komoot führte mich anschließend über Nebenstrecken schnurstracks auf einen Truppenübungsplatz. Die Wachsoldaten nahmen es mit Humor.
Doch am Ende schließe ich Frieden mit der örtlichen Infrastruktur. Es hilft ja nichts. Immerhin bekomme ich noch Schnitte von um die 25 km/h hin, gar nicht so übel angesichts meines Gepäcks. Ich habe eine Rahmentasche und eine nicht sonderlich große “Arschrakete” dabei, ein paar Schuhe sind noch darunter geschnallt. Minimalismus. Zu viel Minimalismus. Nachdem meine privat organisierte humanitäre Hilfsaktion für die Ukraine, die der Radelei vorangegangen war, sehr viel Hirnschmalz verlangte, habe ich ausgerechnet eine Radhose vergessen. Abseits von Lviv an eine solche zu kommen, ist utopisch und mein Zeitfenster zu klein, um nochmal in eine größere Stadt zu fahren. Zu den zum Teil miesen Straßen kommt also noch ein malträtierter Hintern. Nur die Harten kommen in den Garten - und in der Drogerie führt der Weg ans Creme-Regal. Ukrainische Avocado-Hautcreme ist besser als nichts.

Diese Weite, diese Einsamkeit in der Ukraine
Was mich an diesem ersten Tag fasziniert, ist die Weite der Landschaft und die Einsamkeit. Sanft liegen die riesigen Felder unter der prallen Sonne, ein leichtes Lüftchen weht, bis Mittag ist die Temperatur angenehm, dann steigert sich die Schwüle, ehe es zwischen 16 und 17 Uhr gefühlt am drückendsten wird - Zeit, den nächsten Kiosk oder mit “Produkti” überschriebenen Mini-Supermarkt anzulaufen und ein eisgekühltes Kwass, das ukrainische Nationalgetränk, hinunterzugluckern.
In Rawa-Ruska bin ich von Nebenstrecken wieder auf eine stärker befahrene Straße eingebogen, der letzten Nord-Süd-Verbindung vor der polnischen Grenze. Im Grenzstädchchen Jaworiw, das ich bereits letztes Jahr passierte, gönne ich mir ein Motel mit Klimaanlage und einen Riesenburger mit Pommes. Eine Gewitternacht kündigt sich an, es donnert, blitzt und schüttet wie aus Eimern.
Die Klimanlage kann ich nach dem Gewitter ausschalten und das Fenster sperrangelweit öffnen. Ahh, diese Nachtluft tut gut! Der Transitverkehr weckt mich. Ba-bamm, ba-bamm, ba-bamm: Die Lkws donnern über die Schlaglöcher, biegen wenig entfernt Richtung Korczowa ab, dem wohl meistbefahrenen Grenzübergang zwischen der EU und dem kriegsgebeutelten Land.
Am nächsten Morgen mache ich mir mit dem Wasserkocher Kasha, Buchweizenbrei. Ähnlich wie Porridge ist es ein magenschonender Kraftspender, spottbillig und überall zu haben. Um kurz nach sieben werfe ich mich auf die Straße. Es klart auf. Nach einem knappen Kilometer lasse ich die schon jetzt stark befahrene E40 hinter mir. Statt einer schlaglochübersäten Piste empfängt mich makelloser Teer. Ich kann mein Glück kaum fassen! “готель” prangt am einem Bretterverschlag am Waldrand - “Hotel”. Eine Reminiszenz an den Beginn des Krieges, als hier innerhalb kurzer Zeit Tausende die Grenze überquerten und Unterkünfte suchten?
Voller Elan strampele ich durch welliges Gelände in den Vormittag. Doch was ist das? Abrupt endet der Teerbelag und mündet in eine mit Schotter durchsetzte, grobsandige Piste. Durch die intensiven Regenfälle der letzten Nacht ist die Oberfläche aufgeweicht, ich sinke mit meinen 28er Reifen ordentlich ein. Sei’s drum. Ich lasse mir die Freude über das gute Wetter nicht nehmen.

Kein Grenzübergang für Radfahrer
Schüler und Berufspendler stehen an den Bushaltestellen, ich liefere mir ein Rennen mit einer Marshrutka, wie die kleinen Busse in der Ukraine heißen, die hier das Leben aufrecht erhalten und auch das kleinste Dorf anfahren.
Komoot leitet mich schließlich auf immer kleinere Wege - und es schwant mir, dass ich, wenn das so weiter geht, zu langsam vorwärts komme, um meinen Plan einhalten zu können. Als ich laut Route eine Teerstraße überqueren müsste, nur um auf der anderen Seite wieder einem Feldweg zu folgen, reißt mir die Hutschnur. Statt weiter Komoot zu vertrauen, fahre ich einen Umweg.
In Mostyska schlagen die Glocken neun Uhr - wie überall in der Ukraine steht das Alltagsgeschäft für eine Minute still und es wird den Opfern von Russlands Angriffskrieg gedacht. Anschließend wird die Nationalhymne gespielt. Auf dem Stadtplatz erinnern Stelen an die Gefallenen. Jeder legt die Hand auf die Brust. Als am Ende der Hymne das obligatorische “Ruhm der Ukraine! Ruhm den Helden!” ertönt, läuft es mir kalt den Buckel herunter. Anderswo wird gestorben, und ich beschwere mich über mangelhafte Straßen.
Das Wetter entwickelt sich auch heute gut, und so lasse ich nichts anbrennen und wende mich nach Süden, bewusst will ich nicht über die ukrainische Fernstraße M-11 den stark befahrenen Grenzübergang bei Medyka verwenden, sondern einen vermeintlich weniger frequentierten in den Ausläufern der Karpaten. Die Route ist eine zunächst gute Wahl - der Teerbelag ist gut in Schuss. Als ich jedoch auf eine Nebenstrecke abbiege, fühle ich mich wie bei “Superball” auf SAT1 - den Schlaglöchern auszuweichen, gleicht einem Geschicklichkeitsspiel. Stellenweise hört der Teer komplett auf, die Straße verwandelt sich in eine Schotterpiste.
Auch hier wieder fahren nur vereinzelt Autos, der Verkehr konzentriert sich auf die wenigen Straßen mit gutem Belag. Man merkt schlichtweg, dass an den vermutlich schon vor dem Krieg sehr löchrigen Straßen nun gar keine Reparaturen mehr durchgeführt werden. Es wird schwül, in einem kleinen Supermarkt kaufe ich mir Eis, Cola und Wasser und setze mich in den Schatten. Ein Betrunkener findet es offenbar nicht so gut, dass ich mich hier niederlasse, irgendwas will er von mir, die Kommunikation läuft ins Leere, wir beäugen uns skeptisch.
Als ich in Khyriv ankomme, dem letzten Städtchen vor der Grenze, ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann das Gewitter losschlägt. Doch es kommt Wind auf, vertreibt den Wolkenspuk, so schnell wie möglich radle ich die nicht allzu stark befahrene, mit kurzen Steigungen gespickte Straße Richtung Berge - endlich, eine Tanke. Der Tankwart hat jedoch über Mittag dicht gemacht. Mist! Dann eben doch gleich nach Polen…
Die ukrainischen Grenzer machen große Augen, als ich ihnen meinen Plan, mit einem Fahrrad die Grenze zu überqueren, unterbreite: “This border is only for cars!” Tja, aber ich habe kein Auto. Fast muss ich angesichts der absurden Aussage der Beamten lachen. Offenbar ist es Gesetz, dass hier nur Autos rüber dürfen, und Gesetz ist nun mal Gesetz. Nach kurzem Hin- und Her einigen wir uns darauf, dass ich mit dem nächsten Auto, das auch rüber will, die Grenze überqueren darf. Der Punkt ist - die Schranke öffnet sich nur, wenn das per Kamera aufgenommene Nummernschild des Autos mit einer Datenbank abgeglichen wurde - Nummernschild habe ich nun mal keins…
Die Grenzformalitäten selbst ziehen sich. Zuerst ukrainischer Zoll, dann mehrstufige Passkontrolle, dann polnischer Zoll. Eineinhalb Stunden dauert der Grenzübertritt. Dabei dachte ich, hier in den nördlichen Ausläufern der Waldkarpaten ginge es vielleicht etwas schneller…Pustekuchen. Man ist eine EU-Außengrenze als EU- bzw. Schengenraum-Bewohner nicht mehr gewohnt - und vor allem nicht die Schikanen der Zöllner. Selbst Schuld, wer hier mit dem Rennrad unterwegs ist. Und doch ist es der Trotz, der mich antreibt. Rennradfahren trotz Krieg, Radfahren trotz schwieriger Infrastruktur. Rennradfahren als Inbegriff der Freiheit im Angesicht des Terrors.

Neuer Plan für die Heimreise
Nach wenigen Minuten auf polnischen Boden hat mich das Gewitter eingeholt. Eine kleine Kapelle mit einer Marienstatue bietet Schutz vor den Regenmassen. Nach einer halben Stunde hat es so weit aufgehört, dass ich mich wieder davon machen kann. Inzwischen mit der Erkenntnis, dass das nichts wird mit den ganz großen Plänen, bis nach Hause zu radeln. Die Schwüle, die Straßen, auch der Psychoterror an der Grenze, sind eine für die Motivation giftige Kombination. Bis nach Tarnow mache ich noch gute 140 Kilometer voll. Reicht für heute und am nächsten Tag steige ich in den Zug, der mich zurück nach Hause bringt. Das nächste Mal werde ich wieder zum Gravelbike greifen. Es ist für die Ukraine schlichtweg die bessere Wahl.
Hilfe für die Ukraine
Wie bin ich eigentlich nach Brody gekommen? Nun, ich habe einen durch Spendengelder der Osteuropahilfe e.V. (Osteuropahilfe e.V. der Landkreise Starnberg, Tölz und München-Land) finanzierten, gebrauchten Nissan X-Trail 4x4 in die Ukraine gefahren. Darin befand sich neben Hilfsgütern auch mein Rennrad. Auf dem Hinweg übergab ich noch 850 Euro an die NGO “Ptaha”, die sich am Lviver Hauptbahnhof um Binnenflüchtlinge (Internally Displaced Persons, IDPs) kümmert und insbesondere eine Erstversorgung in Form von Essen bereitstellt. Eigentlich wollte ich bei by_porokhova in Lviv noch wenigstens einen Tag Tarnnetze flechten, doch dafür fehlte am Ende die Zeit.
Hinweis: Der Leser-Bericht gibt die Meinung und das Erlebnis des Autors und nicht der Redaktion wieder. Da wir nicht dabei waren können wir nicht überprüfen ob alle Aussagen korrekt sind. Alle geäußerten Meinungen sind Leser-Meinungen und nicht die der TOUR-Redaktion.