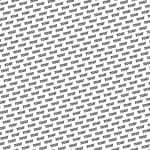Ein Massensturz? Eine geschlossene Bahnschranke? Rennabbruch? Fragen über Fragen rauschen durch meinen Kopf, während ich abbremse. Eben noch sind wir Vollgas einen holperigen Wiesenweg hinabgejagt, dann sehen wir einen wild gestikulierenden Ordner mit Fahne und Trillerpfeife, und jetzt kommen wir mit quietschenden Scheibenbremsen zum Stehen. Und mit “wir” meine ich alle Fahrer um mich herum, plus die circa 80 Fahrer, die bereits vor uns stehen. Eine große Traube bildet sich vor einem Waldstück. Alle recken die Köpfe, was ist los? Ich schiebe mein Rad etwas zur Seite und sehe die Ursache: ein Singletrail. Zwischen einem Zaun und einem Baum passt exakt ein Fahrer hindurch – und dieser Umstand erzeugt einen gewaltigen Rückstau.
Gravel-WM: Fahren, als gäbe es kein Morgen
Während wir warten, dass es weitergeht, fühle ich, wie mein Puls sinkt – zum ersten Mal seit rund anderthalb Stunden. Bis hierhin war diese Gravel-WM eine einzige Jagd. Hinter jeder Kurve wird herausbeschleunigt, mit 600 bis 700 Watt aufs Pedal gedrückt, nur um das Hinterrad zu halten. Die kurzen Anstiege brettern wir mit jeweils 400 Watt und mehr hinauf. Kurz: Wir fahren, als gäbe es kein Morgen. Die erste Rennstunde erinnert mich an die Crossrennen, die ich früher gefahren bin: Immer nahe am Anschlag. Nur dass wir heute nicht eine Stunde fahren, sondern fünf bis sechs. 181 Kilometer Renndistanz, 1500 Höhenmeter, mehr als 60 Prozent davon auf Schotter, Kopfsteinpflaster und Waldwegen. Allein schon die Zahlen machen Angst, und damit bin ich vor dem Rennen nicht allein. Im Startblock blicke ich in angespannte Gesichter, irgendwo zwischen nervös, fokussiert und hochmotiviert.

Der Joseph Possozplein im belgischen Halle ist heute Morgen das Epizentrum der internationalen Gravelszene. Aus allen Seitengassen strömen sie auf den Platz, mal in niederländischem Oranje, italienischem Blau, dänischem Rot, deutschem Weiß, mit amerikanischen Stars and Stripes, aber vor allem natürlich in belgischem Babyblau. Nach zwei Austragungen in Italien kommt die noch junge Gravel-Weltmeisterschaft erstmals in jenes Land, das wie kein zweites den Radsport über Stock und Stein liebt. Doch damit sind die Belgier inzwischen nicht mehr allein: 2613 Starter aus 49 Nationen sind nach Halle gereist – und damit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr (1268) und fast fünfmal so viele wie vor zwei Jahren (556). Gravel boomt einfach immer weiter.
Info Gravel-WM
- Bisherige Austragungen: Vizenza/ Cittadella, Italien (2022), Treviso/Pieve di Soligo, Italien (2023), Halle/Leuven, Belgien (2024)
- Nächste Austragung: Nizza, Frankreich Termin 4.–5. Oktober 2025
- Altersklassen: Neben den Eliteklassen für Profis starten Frauen und Männer in diesen Klassen: 19–34 Jahre, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74, 75–79, 80–84
- Qualifikation: Die besten 25 Prozent jeder Altersklasse in jedem Rennen der UCI World Gravel Series qualifizieren sich für die WM. 2024 gab es weltweit 25 Qualifikationsrennen, 2025 sollen es bis zu 35 werden. Die deutschen Qualifikationsrennen sind bisher 3Rides in Aachen und das Hegau Gravel Race in Singen.
- Startgeld: 125 Euro
Ich selbst merke das auch daran, dass ich das erste Rennen schon vor dem Start verloren habe: den Kampf um einen guten Platz im Startblock. Geschlagene anderthalb Stunden vor dem Startschuss rolle ich an diesem kalten Oktobermorgen in meine Winterjacke gehüllt in den Block – und muss mich dennoch hinten anstellen. Die anderen waren noch früher da. So wie Justus Ossege. Er sitzt auf einem Campingstuhl in Reihe eins, neben ihm sein Porridge und eine wärmende Decke. “Ich war heute früh der Erste hier”, sagt er lachend, “um 8 Uhr war ich da. Da hatte es so sechs Grad.” Sein Vater und sein bester Kumpel sind auch da und unterstützen Justus, der aus der Nähe von Osnabrück kommt, seine Frau und sein Sohn erwarten ihn im Ziel in Leuven, weitere Freunde stehen unterwegs mit Flaschen. Und warum so früh in den Block? “Hier geht’s halt übelst um die Position. Wir starten direkt in einen Feldweg am Kanal, da will ich vorne sein. Ich bin mit Ambitionen hier.”

Alle mit Ambitionen
So wie praktisch alle anderen auch. Mathieu van der Poel rollt auf seinem strahlend weißen Rad an uns vorbei auf dem Weg in den Eliteblock, der als Erstes startet. Danach folgen im Abstand von wenigen Minuten die Amateure in ihren Altersklassen. Alle fahren die gleiche Strecke, die gleiche Distanz – mehr Vergleich mit den Pros geht nicht. Als mein Block dran ist, schießt mir sofort das Adrenalin durch die Blutbahn. Nach 400 Metern geht’s mit Speed auf einen schmalen Weg hinab zum Kanal, doch anders als befürchtet landet keiner von uns im Wasser. Über Kopfsteinpflaster und Feldwege jagen wir dahin, und ganz hinten am Horizont sehe ich die Spitze meiner Altersklasse. Das Peloton ist schon nach wenigen Kilometern extrem lang gezogen und ich bin viel zu weit hinten. Dort tun sich bereits erste Löcher auf, mal weil einer die Kurve nicht kriegt, mal weil das Tempo einfach zu hoch ist. Ich spurte vorbei, ans nächste Hinterrad und irgendwie weiter nach vorne. Der Puls hämmert bereits an meinen Schläfen, aber die Beine sind gut, also weiter – bis wir auf einem Wiesenweg plötzlich alle wegrutschen.

Im Schatten von Maisfeldern hat sich ein Schlammloch gebildet, das kaum jemand fahrend durchquert. Ausklicken, rennen, wieder aufspringen, weiter. Über Schotterwege, Schlaglochpisten, Betonplatten, Waldwege und natürlich grobes belgisches Kopfsteinpflaster. Haarscharf an Pollern vorbei, an der Kante von Betonrinnen, durch Pfützen, im Bunnyhop über riesige Schottersteine. Immer Vollgas, immer auf der letzten Rille.
So geht das jetzt schon anderthalb Stunden und so langsam spüre ich erste Verschleißerscheinungen: Der untere Rücken schmerzt von den Schlägen, Beine und Lunge brennen von den Antritten. Da kommt der erwähnte Stau vor dem Singletrail gar nicht so ungelegen. Als es endlich weitergeht, fällt mir anhand der Startnummern auf, wie bunt gemischt unser Pulk inzwischen ist, viele vor uns gestartete Gruppen haben wir bereits aufgefahren. Niemand weiß mehr, wie er im Rennen liegt. So herrscht in den Wäldern von Brabant ein ständiger Kampf um Positionen, sehr zur Freude des radsportbegeisterten Publikums am Streckenrand. Mehr als 150.000 Zuschauer zählt der Veranstalter entlang der Strecke. Manche sagen, mehr als eine Woche zuvor bei der Straßen-WM in Zürich. Mit viel Gebrüll, wilden Anfeuerungen, sogar La-Ola-Wellen und lauter Partymusik werden wir die Anstiege hochgepeitscht – viel lauter kann es vorne bei den Profis auch nicht gewesen sein.

Die Atmosphäre gleicht einem belgischen Frühjahrklassiker und sie verleitet mich, noch mehr draufzudrücken. Als wir das erste Mal durch den Zielort Leuven jagen, bekomme ich Gänsehaut. Jubel und lautes Geklopfe auf die Werbebanden begleitet unsere Hatz durch das historische Zentrum, ehe wir über einen spiralförmigen Radweg und dann einmal quer durch den Bahnhof jagen. In der Verpflegungszone direkt danach suche ich vergeblich nach meinen Freunden, genauso wie schon in der Zone zuvor.
Jetzt habe ich ein Problem: Meine Flasche ist leer und die zweite ist von einem Schlagloch aus dem Halter katapultiert worden. Als wir aus einem pittoresken Park herausbeschleunigen, geschieht das Unvermeidliche: Meine Beine beginnen zu krampfen. Zu wenig getrunken, die Tankanzeige steht auf Rot.
Ich muss also meine Strategie wechseln: sitzen bleiben, in den Windschatten, Kräfte sparen. Und nach Flaschen Ausschau halten. “Bidon please”, rufe ich in der nächsten Feedzone und tatsächlich gibt mir ein niederländischer Betreuer eine Flasche – dank je wel! Ebenjene fliegt aber kurz darauf auf einer holperigen Abfahrt direkt wieder aus dem Halter und ich fluche laut. Ich blicke mich in meiner Gruppe um und schaue in gezeichnete Gesichter, alle sind platt. Ich auch, doch es sind noch gut 50 Kilometer bis ins Ziel – wenn ich es denn erreiche. Im nächsten Anstieg verliere ich einige Positionen, die Beine sind schwer geworden. Zum Glück reichen mir kurz darauf meine Freunde Kathi und Moritz zwei Flaschen, meine Rettung.
Gel statt Fritten
Als wir erneut Leuven passieren, weht mir der Duft von belgischen Fritten in die Nase. Kurz male ich mir aus, wie köstlich die jetzt schmecken würden – und zwinge mir stattdessen das nächste klebrige Gel rein. Die letzte Runde ist zäh, manche meiner Mistreiter sind stehend k.o., verweigern die Führungsarbeit. Mir geben die Trinkflaschen wieder neue Energie, und als aus unserer Gruppe attackiert wird, gehe ich mit. Mit viel Speed schießen wir über einen abschüssigen Kopfsteinpflasterweg auf eine Kurve zu und wie aus dem Nichts liege ich am Boden. Etwas Sand in der Kurve kostet mich den Grip und einiges an Haut. “Wollen Sie weiterfahren?”, fragt mich ein freundlicher Ordner auf Deutsch und hält mir schon mein Bike hin. Was für eine Frage.
Ich setze mich mit krampfender Wade in den Sattel und versuche wieder in Gang zu kommen. Die Schaltung zickt, Ellenbogen und Knie bluten und schmerzen. Nebensächlich. Der nächste Anstieg wartet. Und dann erreichen wir endlich Leuven: Ein letztes Mal im Wiegetritt den steilen, schmalen Ramberg hinauf, alles keucht. Und schon sind wir mitten im Zielsprint. Noch einmal alles ins Pedal drücken, was noch an Kraft in den Beinen ist – dann ist’s geschafft. Als 45. meiner Altersklasse rolle ich über den Zielstrich. Erschöpft klicke ich aus und schnaufe durch.

Aus dem VIP-Bereich hält mir ein Belgier lachend und wohl etwas mitleidig sein Bierglas hin und ich nehme dankend an. Mit einem Zug ist es leer. Als mir kurz danach mein Kumpel Marius noch eine Tüte duftender goldgelber Fritten reicht, strahle ich. Mehr Belgien an einem Tag geht nicht.